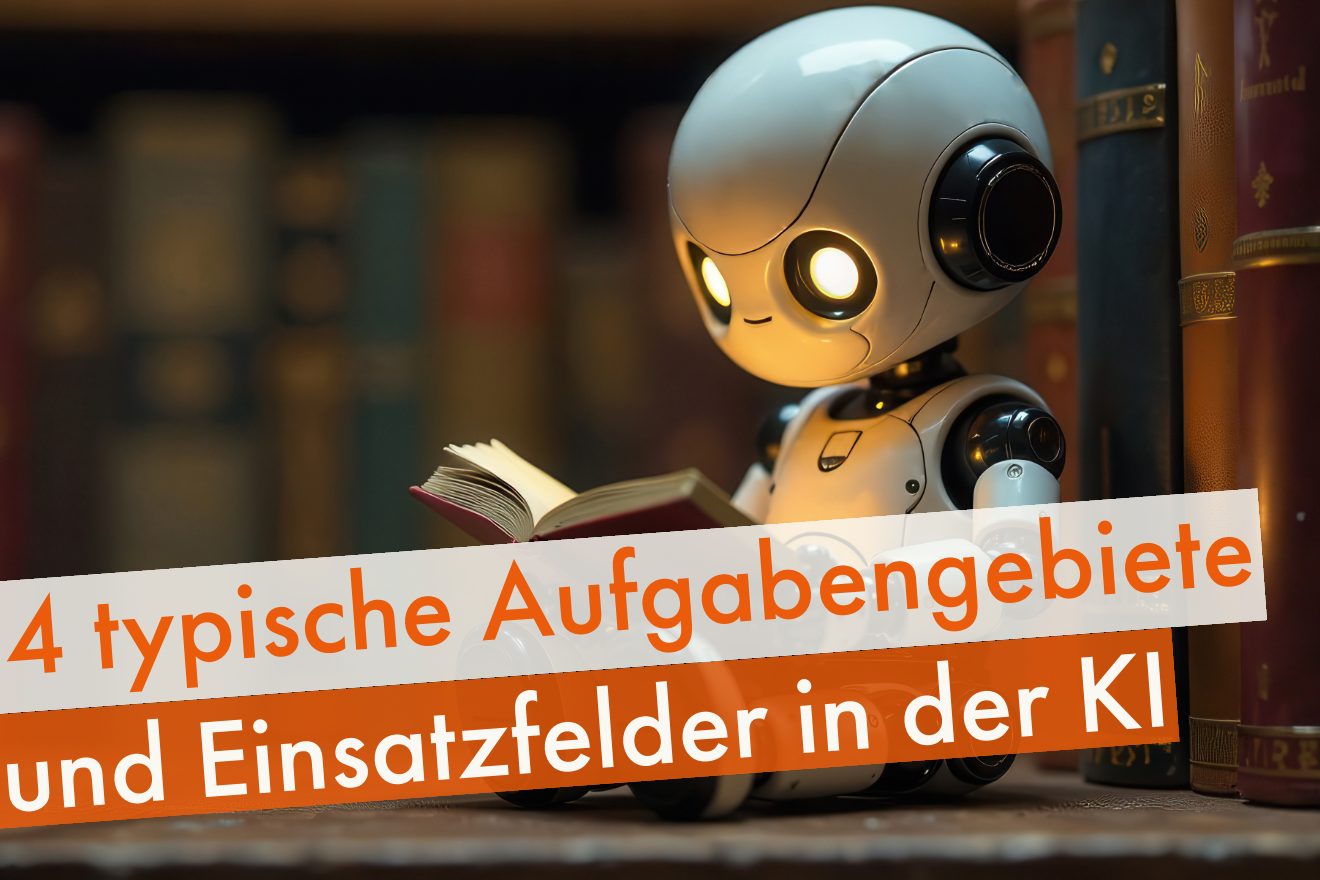- LeistungenDas bieten wir an
- ReferenzenCase Studys & Erfolgsgeschichten
- WissenWiki, Artikel, Trends
3 typische Probleme bei der KI-Implementierung und was Sie dagegen tun können
Knowhow herunterladen

Viele Unternehmen investieren in KI – doch nur wenige schaffen es, die Technologie wirklich erfolgreich einzusetzen. Erfahren Sie hier, an welchen drei typischen Stolpersteinen KI-Projekte scheitern und wie Sie diese vermeiden können.
Künstliche Intelligenz verspricht enormes wirtschaftliches Potenzial. Weltweit werden die möglichen Wertschöpfungsgewinne durch KI-Technologien inzwischen auf mehrere Billionen US-Dollar geschätzt. Das entspricht in etwa der wirtschaftlichen Leistung von China, Deutschland und Japan zusammen. Kein Wunder also, dass sich derzeit Unternehmen aller Branchen darum bemühen, sich ihr Stück dieses gigantischen Kuchens zu sichern.
Doch die Realität – insbesondere im deutschsprachigen Raum – sieht ernüchternd aus: Laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft haben lediglich 6 % der Unternehmen KI-Technologie flächendeckend in ihrer Organisation etabliert. Ein Drittel testet sie gerade einmal aus, während fast die Hälfte der Unternehmen noch gar keine KI in ihren Prozessen nutzt.
Warum gelingt es nur so wenigen, dieses Potenzial in die Praxis zu bringen? Warum scheitern so viele an der Umsetzung? Dieser Beitrag geht nicht nur diesen Fragen auf den Grund, er zeigt Ihnen zudem drei typische Stolperfallen bei der Implementierung von KI-Projekten und wie Sie diese vermeiden können, um Ihr Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs zu bringen.
Vom Potenzial zur Realität: Warum KI-Initiativen oft ins Stocken geraten
Viele Unternehmen wollen loslegen, doch auf dem Weg von der Vision zur konkreten Umsetzung tauchen schnell unerwartete Hürden auf. Nicht selten liegt es dabei weniger an der Technologie selbst, sondern an strukturellen, organisatorischen und strategischen Fehlern, die schon früh im Prozess gemacht werden.
Drei dieser Stolpersteine begegnen uns in der Praxis immer wieder:
Problem 1: Dezentralisierte KI-Projekte – wenn KI zur Insel-Lösung wird
Der Begriff „Insel-KI“ beschreibt ein Phänomen, das in vielen Unternehmen zu beobachten ist: KI wird zwar eingeführt, aber dezentral, unkoordiniert und isoliert in einzelnen Abteilungen. Logistik, Controlling, Vertrieb, Kundenservice – überall entstehen kleine, eigenständige KI-Initiativen, die nur auf die Bedürfnisse der jeweiligen Fachbereiche ausgerichtet sind. Was zunächst nach Innovation klingt, führt in der Praxis zu erheblichen Problemen: fehlende Skalierbarkeit, doppelte Kosten, keine Synergien, mangelnde Transparenz und enorme Governance-Risiken.
Das Resultat ist ein Flickenteppich aus Lösungen, der kaum zu managen ist. Durch unterschiedliche Technologien, redundante Entwicklungen und keine gemeinsame Datenbasis verliert ein Unternehmen schnell die Kontrolle über die eigene KI-Landschaft. Auch regulatorische Anforderungen oder interne Compliance-Vorgaben lassen sich unter diesen Bedingungen kaum zuverlässig erfüllen.
Die Lösung: eine unternehmensweite KI-Basisstrategie
Der entscheidende Hebel liegt in der strategischen Zentralisierung: Mit einer klaren, unternehmensweiten KI-Basisstrategie lassen sich Rahmenbedingungen schaffen, die den Einsatz von KI im gesamten Unternehmen lenken, ohne Innovationskraft in den Fachbereichen zu blockieren. Diese Strategie definiert ein gemeinsames Zielbild, abgestimmte Governance-Strukturen, zentrale Infrastrukturkomponenten und verbindliche Prinzipien für den KI-Einsatz.
Fachbereiche können und sollen weiterhin eigenständig ihre KI-Potenziale innerhalb eines klaren Rahmens heben. So wird sichergestellt, dass Projekte aufeinander abgestimmt sind, Synergien genutzt und Entwicklungen wiederverwendet werden können. Gleichzeitig wird die Einhaltung regulatorischer Vorgaben erleichtert, Betriebskosten sinken, und die Innovationsgeschwindigkeit steigt.
Unternehmen, die diesen Schritt konsequent gehen, schaffen die Grundlage für eine nachhaltige, skalierbare und steuerbare KI-Transformation. Nicht durch Kontrolle, sondern durch gezielte Koordination. Nicht durch Verlangsamung, sondern durch intelligente Ausrichtung. Die KI-Basisstrategie wird damit vom „Bremser“ zum eigentlichen Beschleuniger.
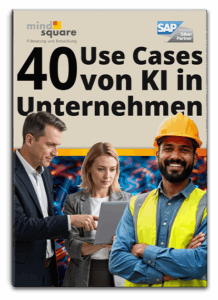
NEU: E-Book: 40 Use Cases von KI in Unternehmen
In diesem kostenlosen E-Book finden Sie konkrete Beispiele, wie KI in den verschiedensten Abteilungen eines Unternehmens Mehrwert schaffen kann.
NEU: E-Book: 40 Use Cases von KI in Unternehmen
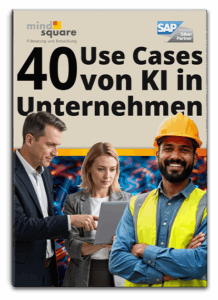
Problem 2: Homogene KI-Teams – wenn wichtige Perspektiven fehlen
Selbst wenn Unternehmen erkannt haben, dass KI ein strategisches Thema ist, das nicht nebenbei mitlaufen darf, bleibt ein entscheidender Fehler häufig bestehen: Die Zusammensetzung der verantwortlichen Teams. Viel zu oft liegt die Verantwortung für KI-Initiativen bei wenigen technikorientierten Entscheidern aus IT und Management. Das führt dazu, dass wichtige Perspektiven aus Fachbereichen und operativer Praxis fehlen, was schwerwiegende Folgen für Akzeptanz, Nutzen und tatsächliche Wirksamkeit von KI-Lösungen mit sich bringt.
Typisch ist folgendes Szenario: Das Top-Management erkennt die Chancen und fordert getrieben von Innovationsdruck, Wettbewerb und Return-on-Invest-Erwartungen „mehr KI“. Die Umsetzung wird dann häufig der IT überlassen, die allerdings mit einem ganz anderen Zielverständnis an das Thema herangeht: stabile Systeme, Sicherheit, Skalierbarkeit, Compliance. Zwischen diesen beiden Polen entstehen zwar KI-Lösungen, doch oft vorbei an den Bedürfnissen derjenigen, die sie später nutzen sollen. Es entsteht, was wir das „Elfenbeinturm-Risiko“ nennen: Lösungen werden am Schreibtisch geplant, aber nicht im Unternehmensalltag verankert. Die Folge ist geringe Nutzung, Ablehnung, Frustration und verpasste Potenziale.
Die Lösung: ein interdisziplinäres KI-Transformation Office
Die wirksamste Antwort auf dieses Problem ist der Aufbau eines interdisziplinären Steuerungsgremiums, eines sogenannten KI-Transformation Office. Dabei soll es sich nicht um eine neue Abteilung handeln, sondern um ein übergreifendes Organ, das zentrale Verantwortung übernimmt und gleichzeitig alle relevanten Perspektiven einbindet. Neben IT und Management gehören hierzu vor allem Vertreter aus den Fachbereichen, zum Beispiel aus Vertrieb, Service, Einkauf oder Produktion. Diese fungieren als „KI Scouts“, die aus ihrer operativen Praxis heraus Ideen, Herausforderungen und Potenziale einbringen.
Ergänzt wird das Gremium idealerweise durch externe Partner – etwa Technologie- oder Umsetzungspartner wie mindsquare– die zusätzliche Perspektiven, Best Practices und Innovationsimpulse aus anderen Branchen einbringen. Geleitet wird das Transformation Office von einer zentralen KI-Verantwortung, die Koordination, Priorisierung und Umsetzung der Projekte sicherstellt.
Entscheidend ist dabei: Das Transformation Office agiert als Vermittler zwischen strategischer Vision und operativer Realität. Es sorgt dafür, dass neue KI-Projekte von Anfang an mit den richtigen Stakeholdern geplant werden, egal ob es Entscheider im Management, technische Umsetzer in der IT, Datenschutzbeauftragte oder eben die späteren Nutzer in den Fachbereichen sind. So entstehen Lösungen, die nicht nur technisch machbar, sondern auch praktisch wirksam und akzeptiert sind.
Unternehmen, die auf diese Struktur setzen, schaffen die Basis für nachhaltige Transformation: nicht top-down, nicht nur technisch, sondern integriert, praxisnah und mit echtem Mehrwert für das gesamte Unternehmen.
Problem 3: Kein Fokus auf die richtigen Potenzialbereiche – wenn KI ohne Zielrichtung eingesetzt wird
Die unzähligen Möglichkeiten von KI sind oft auch Teil des Problems. Denn was in der Theorie nach grenzenlosem Potenzial klingt, führt in der Praxis häufig zu einem unsystematischen, ungezielten Einsatz. Es wird „irgendetwas mit KI“ gemacht, aber nicht unbedingt das, was strategisch sinnvoll, wirtschaftlich relevant oder kurzfristig wirksam wäre.
Das Ergebnis: Projekte werden gestartet, weil sie technologisch spannend wirken oder bei Wettbewerbern gerade erfolgreich laufen. Oft sind es Showcase-Projekte ohne direkten Mehrwert für das eigene Geschäftsmodell. Was fehlt ist eine strukturierte Analyse: Wo liegen eigentlich die größten Hebel im eigenen Unternehmen? Welche Bereiche profitieren wirklich von KI und welche vielleicht (noch) nicht?
Die Lösung: systematische Analyse von Potenzialbereichen statt Blindflug
Statt sich von einzelnen Use Cases leiten zu lassen, sollte die KI-Transformation mit einer klaren Ziel- und Potenzialanalyse beginnen. Der Fokus liegt nicht auf dem, was technisch möglich ist, sondern auf dem, was für das Unternehmen sinnvoll ist.
Dabei hilft ein einfaches, praxisbewährtes Modell: KI lässt sich, unabhängig von der konkreten Branche, auf vier grundlegende Wirkungsfelder zurückführen:
- Produktivität steigern (z. B. automatisierte Texterstellung, Zusammenfassungen, visuelle Inhalte)
- Assistenz bei wissensintensiven Aufgaben (z. B. Vertragsanalyse, Produktempfehlungen, Informationsrecherche)
- Automatisierung unstrukturierter Daten (z. B. Verarbeitung von PDFs, Besuchsberichten, handschriftlichen Skizzen)
- Intelligente Analysen (z. B. datengetriebene Prognosen, Trendanalysen, Entscheidungsunterstützung)
Indem diese vier Funktionen systematisch auf die eigenen Unternehmensbereiche gemappt werden, lassen sich schnell konkrete Potenzialfelder identifizieren. In vielen Fällen sind das Bereiche wie Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Beratung oder Einkauf, also Prozesse mit hohem Kommunikations- und Datenaufkommen, klaren Routinen und viel manuellem Aufwand.
Mit dieser strukturierten Herangehensweise wird aus der theoretischen Vielfalt eine klare Handlungspriorisierung. Projekte, die echten Mehrwert schaffen, rücken automatisch nach vorn. Zeit, Geld und Ressourcen werden dort investiert, wo sie kurzfristig Wirkung entfalten und gleichzeitig den Boden für langfristige Skalierung bereiten. Unternehmen, die so vorgehen, stellen sicher, dass ihre KI-Reise nicht im Nebel beginnt, sondern mit klarem Kurs auf echten Nutzen und wirtschaftliche Relevanz.



Fazit: KI-Transformation braucht mehr als nur Technologie
Der Weg zur erfolgreichen KI-Implementierung ist kein Selbstläufer. Wer echte Mehrwerte schaffen will, muss typische Fallstricke vermeiden und klare Strukturen schaffen: weg von isolierten Insellösungen, hin zu einer strategisch ausgerichteten Basis. Weg von homogenen Techniker-Teams, hin zu interdisziplinärer Verantwortung. Und vor allem weg vom blinden Aktionismus, hin zur bewussten Auswahl relevanter Potenzialbereiche.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die KI-Transformation gezielt und wirkungsvoll anzugehen. Unternehmen, die diese Prinzipien frühzeitig verankern, schaffen nicht nur die Grundlage für schnelle Erfolge, sondern sichern sich stattdessen langfristig echte Wettbewerbsvorteile statt nur hinterherzulaufen.
Der erste Schritt? Klare Potenziale erkennen, eine konkrete Roadmap entwickeln und die Umsetzung starten: Informieren Sie sich hier über eine KI Potenzialanalyse.
Nutzen Sie Künstliche Intelligenz, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen voranzutreiben.
Verwandte Beiträge
Beratung und Unterstützung für die Unternehmens-IT
- Individualentwicklung für SAP und Salesforce
- SAP S/4HANA-Strategieentwicklung, Einführung, Migration
- Mobile App Komplettlösungen – von der Idee über die Entwicklung und Einführung bis zum Betrieb, für SAP Fiori und Salesforce Lightning
- Automatisierung von Prozessen durch Schnittstellen, künstliche Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA)
- Beratung, Entwicklung, Einführung
- Formular- und Outputmanagement, E-Rechnung & SAP DRC
- SAP Archivierung und SAP ILM
- SAP Basis & Security, Enterprise IT-Security & Datenschutz
- SAP BI & Analytics
- Low Code / No Code – Lösungen
Vollumfängliche Implementierungs- und Betriebsunterstützung für führende Softwareprodukte unserer Partnerunternehmen:

Besondere Prozessexzellenz im Bereich Personal / HR
- Knowhow in Personalprozessen und IT-Technologien verbinden
- HR-Berater, die IT-ler und Personaler in einer Person sind
- Beratung zu HR IT Landschafts- & Roadmap sowie HR Software Auswahl
- Beratung und Entwicklung im SAP HCM, SuccessFactors und der SAP Business Technology Platform
- HCM for S/4HANA (H4S4) Migration & Support
- Als Advisory Partner Plattform und Prozessberatung in Workday
- Mobile Development mit SAP Fiori, SAPUI5, HTML5 und JavaScript
- Marktführer im Bereich ESS/MSS
Vollumfängliche Implementierungs- und Betriebsunterstützung für führende Softwareprodukte unserer Partnerunternehmen:

Besondere Prozessexzellenz im Bereich Produktion & Logistik
- Optimierung und Digitalisierung von Produktions- und Logistikprozessen sowie Einkaufs- und Vertriebsprozessen
- Einführung mobiler Datenerfassung in Produktion, Lager und Instandhaltung
- Umfassendes Knowhow in den SAP-Modulen LO, MM, SD, WM, PM und CCS/CCM
- Modul-Beratung & Einführung, Entwicklung individueller (mobiler) Anwendungen
- Beratung und Entwicklung in der SAP Freischaltungsabwicklung (SAP WCM, eWCM)
- Optimierung sämtlicher Prozesse im Bereich der nachträglichen Vergütung (Bonus)
Vollumfängliche Implementierungs- und Betriebsunterstützung für führende Softwareprodukte unserer Partnerunternehmen:

Besondere Prozessexzellenz im Bereich Vertrieb & Service
- Vertriebs- & Service-Prozesse auf Basis von Salesforce
- Beratung, Einführung und Entwicklung für Salesforce-Lösungen: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud inkl. Account Engagement (ehem. Pardot)
- Salesforce Customizing: Individuelle Lösungen in Salesforce, u.a. für Chemie-Branche
- Betriebsunterstützung und Service für Salesforce-Kunden
- Schnittstellen-Entwicklung, besondere Expertise SAP – Salesforce Integration
Vollumfängliche Implementierungs- und Betriebsunterstützung für führende Softwareprodukte unserer Partnerunternehmen:

msDevSupport
Service / Development Support
- fester, eingearbeiteter Ansprechpartner als Koordinator
- kontinuierliche Weiterentwicklung und Digitalisierung Ihres Unternehmens, z.B. Fehlerbehebung, Updates, neue Features implementieren
- kleinere Entwicklungen realisieren, die kein Projektmanagement erfordern
- günstige Abrechnungen pro h
- sehr einfache und schnelle Beauftragung auf Zuruf
- ständige Verfügbarkeit: (Teil-)Ressourcen geblockt für Sie
- kurze Reaktionszeiten 2 – 24h
- Wir halten Wissen vor und stellen Stellvertretung sicher
msSolution
Projekte
- Projektleitung und Steering inklusive Qualitätssicherung
- „Wir machen Ihr fachliches Problem zu unserem.“
- mindsquare steuert IT-Experten selbst
- Abrechnung pro Tag
- Längerer Angebots- und Beauftragungsprozess
- Lieferzeit 6 – 12 Wochen ab Auftragseingang
- Zum Auftragsende Transition zu einem Service & Support notwendig, um schnell helfen zu können
msPeople
IT-Experten auf Zeit
- Wir lösen Ihren personellen Engpass, z.B. liefern von IT-Experten für Ihr laufendes Projekt
- Breites Experten-Netzwerk für praktisch jedes Thema und Budget:
- interne festangestellte mindsquare Mitarbeiter:innen
- externe Experten aus unserem Netzwerk von 27.000 Freiberufler:innen aus Deutschland
- externe Experten im Nearshoring mit derzeit 37 Partnern
- Verbindliches Buchen der Experten in einem definierten Zeitraum an festen Tagen
- Ohne Projektleitung und Steering, Sie steuern die Experten
- Lieferzeit in der Regel 2 – 6 Wochen
- Nach Auftragsende KEIN Vorhalten von Experten und Knowhow